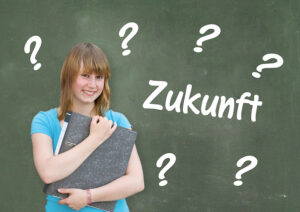2. UVN-Bildungs-Summit: Berufsorientierung als Schlüssel zum Erfolg/VLWN aktiv dabei
Unternehmerische Agilität trifft auf ein starr-verkrustetes Schulsystem, das in der Preußenzeit verhaftet ist. Da ist jeder Dialog zum Scheitern verurteilt. Denn der eine versteht die Bedürfnisse des anderen nicht. Angesichts des branchenübergreifenden Fachkräftemangels ist es zwingend erforderlich, einen belastbaren Gesprächsfaden zwischen Wirtschaft und Schule zu spannen.
Genau das war auch Ziel des 2. UVN-Bildungs-Summit im Karriere Campus Hannover, den der VLWN aktiv mitgestaltet hat. Ulf Jürgensen, Vorstandsmitglied und Schulleiter der BBS Burgdorf, appellierte in seiner Funktion als schulseitiger Vorstand von SCHULEWIRTSCHAFT Niedersachen in der Podiumsdiskussion mit Bianca Rosenhagen dafür „dass Wirtschaft und Schule eine Sprache sprechen und das Miteinander durch Partnerschaften auch leben müssen.“ Das sei die tragfähige Basis für ein gutes Matching bei der Berufswahl. 250 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen waren der Einladung zum Austausch gefolgt. Zentrales Thema: „Berufsorientierung: Die Lösung für den Fachkräftemangel!“
„In den letzten zehn Jahren erleben wir das Phänomen, dass immer mehr Lehrstellen unbesetzt bleiben, zeitglich aber auch viele Jugendliche unversorgt bleiben und keine Lehrstelle finden. Um aus diesem Dilemma rauszukommen, ist eine fundierte Berufsorientierung essenziell. Um hier erfolgsreich zu sein, müssen wir Schule und Wirtschaft deutlich stärker verzahnen. Das Problem dabei ist nur, dass beide Parteien einen sehr fokussierten Blickwinkel nur auf die eigenen Bedürfnisse haben und eine diametral zueinander verankerte Denke haben. Das muss sich ändern, indem wir offen aufeinander zugehen, die Bedürfnisse des anderen lernen zu verstehen, indem beispielsweise Ausbilder und Lehrkräfte für einen Tag den Job wechseln und in den Alltag des jeweils andern eintauchen“, sagte Christoph Meinecke, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), in seiner Begrüßungsrede.
Der Vorschlag, den Perspektivwechsel durch Selbsterfahrung herbeizuführen, fand rege Zustimmung – und wurde gleich weiter gedacht: Warum nicht Lehrkräfte für eine Praktikumswoche in einen Betrieb hinein schnuppern lassen und umgekehrt. Den nötigen Freiraum dafür gibt es bereits heute. Das bestätigte Kultusministerin Julia Willie Hamburg als Gastrednerin ebenso wie Carsten Ruge, Rektor der GOBS, als Impulsredner für „Wie funktionert Berufsleben: Berufsorientierung an der GOBS Gehrden“, der diesen Freiraum bereits lebt.
„Es gibt so viele tolle handwerkliche Berufe, die vielfach unbekannt sind und deshalb bei der Berufsorientierung logischerweise nicht berücksichtigt werden. Der aktuelle Erlass für Berufsorientierung wurde 2018 in die Praxis umgesetzt. Die Evaluation hat gezeigt, wo wir noch nachbessern müssen. In zahlreichen Werkstattgesprächen mit der Wirtschaft haben wir Impulse gesammelt, um die Lücken zu schließen, die in den neuen Erlass eingeflossen sind, der demnächst kommt. So soll beispielsweise die Berufsorientierung in den Gymnasien deutlich gestärkt werden. Um die jungen Menschen frühzeitig mit der Wirtschaft in Kontakt zu bringen, wird es künftig bereits in der Sek. 1 ein Praktikum geben“, sagte Julia Willie Hamburg.
Parallel dazu setzt die Kultusministerin auf die Experten der beruflichen Bildung, die Berufsbildner, deren Expertise sie stärker nutzen möchte. „Wir müssen auch die Schulformen weiter verzahnen und BBS-Lehrkräfte als Botschafter für die Sache selbst schon in die Grundschulen holen. Denn der Schulwechsel nach der Grundschule ist prägend für den weiteren Weg. Wer aufs Gymnasium geht, will und soll in der Regel studieren.“ Der neue Erlass beinhalte aber auch deutlich mehr Freiräume für Schulen, um neben Pflichtpraktika Möglichkeiten zu schaffen, Klassenraum und Werkbank anzunähern. „Praktiker aus dem Berufsalltag können in die Schule kommen und Lehrinhalte mitgestalten. Das geht schon jetzt und bietet einen unglaublichen Mehrwert. Im Gegenzug können Lehrkräfte in Unternehmen hospitieren, um zu erleben, wie ein Unternehmen tickt und was im Betrieb gebraucht wird“, sagte Hamburg.
Ein Positivbeispiel, wie Handwerk spielerisch schon für die Jüngsten erlebbar wird und prägend wirkt, stellte Ina de Groot vor. Sie leitet in Schwerin die Handwerks-Kita „Alles im Lot“. Ab dem zweiten Lebensjahr schreinern, hämmern und sägen die Kleinen in Begleitung von gestandenen Handwerkern aus der Region und einer Handwerkspädagogin in einer 60 qm großen, voll ausgestatteten Werkstatt ihr Spielzeug selbst.
Das Wort „Selbst“ ist für Carsten Huge, Rektor der GOBS, essenziell und hat in seinem Verständnis von Lernen eine tragende Bedeutung. „Selbstständig lernen Schülerinnen und Schüler im Regelfall nicht. Ihnen wird vorgebetet, wann sie was zu lernen haben. Daher brauchen wir einen Rollenwechsel weg vom Konsumenten hin zum Gestalter. Wer sein eigenes Ziel mit Lust verfolgt, wird aktiver Teil seiner eigenen Bildung“, sagt der Pädagoge, der an der GOBS Gehrden das offene Lernen installiert hat. Hier können die Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt und örtlich unabhängig dann das lernen, was sie gerade interessiert. Die Lehrkräfte sind Lerncoaches, die Lerninhalte in der Cloud zur Verfügung stellen. „Wir sind seit zwölf Jahren vollständig digitalisiert, was ein wichtiger Unterbau für das freie Lernen ist.“
Darüber hinaus pflegt Huge Kooperationen mit VW und der DB, wo seine Schülerinnen und Schüler projektiv schnuppern können und die Unternehmen im Gegenzug auch Lehrinhalte beisteuern. Kommuniziert wird mit den Schülerinnen und Schülern auch schon mal über WhatsApp und TikTok, weil die Jugendlichen da unterwegs sind. „Von denen liest doch keiner eine Mail“, sagte Huge. Und die schuleigene Kantine wird im Fach Wirtschaft von den Schülerinnen und Schülern bewirtschaftet: Einkauf, Lagerhaltung, Kalkulation und mehr praktisch lernen. „So leben wir Berufsorientierung“, sagte Huge.
Für Prof. Dr. Johannes Siebert vom Managementcenter Innsbruck, ist der zentrale Schlüssel für die Berufsorientierung, „die Wirkungskraft und die Folgen des eigenen Handelns zu verinnerlichen und in die Entscheidungsanalyse einfließen zu lassen. Dieser klassische drohgebärdende Wenn-Dann-Rahmen, der allgegenwärtig ist, führt zur Verweigerung. Durch Entscheidungskompetenz werden junge Menschen selbstbewusster, erfolgreicher und resistenter. Also muss man die jungen Menschen selbstbestimmt entscheiden lassen und die daraus resultierenden Erfahrungen sind der relevante Lernprozess. – auch mit Blick auf die Berufswahl.“
Holger Meyer, Geschäftsführer Bechtle IT-Systemhäuser Bielefeld und Hannover, und Christian Jahnke, Studienrat der Sekundarschule Soest, stellten im Duo die gelebte, sehr praxisorientierte Kooperation zwischen Wirtschaft und Schule mit Schwerpunkt IT vor. „Die Jugendlichen sind IT-affin und verfügen über eine Digitalkompetenz. Das muss man fördern. Warum muss es immer ein geschriebener Text sein, warum keine Audiodatei, die zur Leistungsbewertung herangezogen wird. Da sind wir nämlich in der Lebensrealität der Jugendlichen unterwegs. Die senden Sprachbotschaften und schreiben nicht. Die Technik ist im Grunde da, die Schulen sind weitestgehend digitalisiert. Die Art und Weise, wie damit gearbeitet wird, ist das nächste Level, das wir beschreiten müssen. Ansonsten bleibt es beim Wischen über den Bildschirm“, sagte Meyer. Und Jahnke ergänzte: „IT praxisorientiert nutzen, heißt auch, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, wofür beispielsweise eine Ordnerstruktur notwendig ist – nämlich als Ablagesystem, in dem man alles wiederfindet.“
Prof. Dr. Birgit Reißig vom Deutschen Jugendinstitut e.V. lieferte als letzte Impulsrednerin Zahlen, Daten und Fakten aus der Forschung: 45 % aller Kinder gehen nach der Grundschule aufs Gymnasium. Die Studienberechtigungsquote eines Altersjahrgangs liegt bei 48 %. Über alle Bildungsgänge hinweg zeigen sich verlängerte Übergänge. „Wir sprechen hier von einer Scholarisierung der Jugendphase, die fatal ist“, sagte Prof. Dr. Reißig. Die Folge daraus: Die Passungsprobleme zwischen Jugendlichen und Betrieben werden immer größer – Ausbildungsstellen (68 900) blieben 2023 unbesetzt, Jugendliche (60 400) gleichzeitig unversorgt. „Praktika sind essenziell für die Berufsorientierung, sagen 46 % der Jugendlichen. Medien sind hingegen weit abgeschlagen (16%) und die Berufsberatung kommt beim Voting auf 18 %. Deshalb mehr Praxis in die Schulen, mehr Vernetzung zwischen Wirtschaft und Schule“, forderte Reißig.
Die anschließende Podiumsdiskussion, an der unter anderem auch Ralf Neugschwender (VDR Bundesvorsitzender) teilnahm, stand unter dem Motto: „Wünsch Dir was“. Unisono – vom Schulelternrat bis hin zum Wirtschafttsvertreter – hieß es da: Die Schulen brauchen mehr Ressourcen – Geld, Personal, Zeit – um Partnerschaften mit der Wirtschaft zu leben, die Inhalte an die Schulen zu holen, um eine gute Berufsorientierung zu gewährleisten. „Es ist zu hoffen, dass von dem gerade verabschiedeten Sondervermögen für die Infrastruktur auch Geld in die maroden Schulen fließt, wo aktuell ein Investitionsstau von 55 Milliarden herrscht. Wir brauchen zuallererst einmal Lernorte, wo das Lernen Spaß macht. Marode Schulen sind das Gegenteil davon“, sagte Neu-gschwender.
Stefan Schlutter